 Bildrechte: Dr. Königstedt - BRV
Bildrechte: Dr. Königstedt - BRVIn der Elbmarsch
Die ehemals überflutete Elbaue zieht sich bis 16 Kilometer ins Land hinein. Periodische Hochwässer lagerten hier ihre mitgebrachte Schwebstofffracht ab und ließen die fruchtbaren Aueböden entstehen.
Erst im Schutz der Deiche konnte eine Besiedlung und ackerbauliche Nutzung erfolgen. Es entstand eine Kulturlandschaft, die heute noch das Landschaftsbild prägt. Beispiele sind die Marschhufen in der Lüneburger Elbmarsch, Beetgräben oder Grüppen in Deichnähe, Kopfweiden, Obstbaumallen und Häuser, die direkt hinterm Deich oft auf Warften oder Wurten errichtet wurden und auf deren Dächern vielerorts Storchennester zu finden sind.
Die Grünländer und Äcker geben der Elbmarsch als Nahrungslebensraum für den Weißstorch eine hohe Bedeutung. Auch nordische Gänse und Schwäne sowie Kraniche profitieren während der Winterrast oder des Zuges von den landwirtschaftlichen Kulturen. Rückzugsräume für zahlreiche bedrohte Arten gibt es in den Qualmwasserbereichen und Bracks am Deich.
Durch Hecken, Feldgehölze, Baumreihen und markante Einzelbäume erhält die Kulturlandschaft eine abwechslungsreiche Struktur. Dies nutzen unter anderem Neuntöter, Sperbergrasmücke, Nachtigall, Ortolan, Braun- und Schwarzkehlchen, um ihre Jungen großzuziehen. Eine besonders hohe Artenvielfalt besitzen auch die Reste alter und feuchter Laubmischwälder, in denen neben Rot- und Schwarzmilan und Schwarz- und Mittelspecht selbst Seeadler und Schwarzstorch heimisch sind.
 Bildrechte: Dr. Königstedt - BRV
Bildrechte: Dr. Königstedt - BRVArtikel-Informationen
erstellt am:
18.05.2005
zuletzt aktualisiert am:
06.05.2010

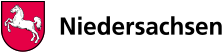

 english
english